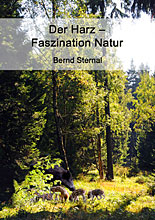|
 Der Waldmeister Der Waldmeister
|
„Im dämmernden Walde mit süßen Düften wächst in der
Wildnis ein zierliches Würzkraut,
ein feines Pflänzchen, Waldmeister genannt.“
H.Seibel
Wie lange der Mensch das Würzkraut Waldmeister bereits
nutzt, wissen wir nicht. Überliefert ist aber von Mönch
Wandelbertus aus dem Kloster Prünn in der Eifel, aus dem
Jahr 854, ein mit Waldmeister gewürzter Maitrank. In den
Kräuterbüchern des Mittelalters nahm der Waldmeister
einen festen Platz ein.
Besonders empfohlen wurde er als Stärkungsmittel für die
Leber, was ihm auch den Beinamen Leberkraut einbrachte.
Johannes Trojan schrieb dazu folgendes: „Anfangs wurde
der Maitrank hauptsächlich zur Stärkung der Leber
getrunken, dann, als man hinter den Wohlgeschmack dieser
Medizin gekommen war, zur Herzerfreuung, wozu er heute
ausschließlich verwendet wird und zwar, wie ich glaube,
in einem Maße, dass es für die Leber fast schon zu viel
wird.“

Auch gilt der Waldmeister, der aus der Gattung der
Labkräuter stammt, als Wetterprophet; naht der Regen, so
duftet er besonders stark und lieblich, bei schönem
Wetter ist er oftmals duftlos.
Der Duftstoff
des Waldmeisters, der botanisch Asperula odorata
genannt wird, findet sich in allen Teilen der Pflanze
und tritt vor der Blüte, von April bis Mai, besonders
stark hervor.
Dieser Duft- und Wirkstoff wird Cumarin genannt
und wirkt gefäßerweiternd, entzündungshemmend und
krampflösend, spielt aber heute in der Schulmedizin kaum
noch eine Rolle.
Der Waldmeister ist ein echtes Kind des Harzer Waldes
und kommt bis in die Hochlagen des Gebirges vor.
Besonders liebt er den Schatten der Buchenwälder, ja er
gilt sogar als ausgesprochener Buchenbegleiter.
Allerdings benötigt er im Frühjahr, um seine Blätter und
Blüten entfalten zu können, das Sonnenlicht. Ist das
Laubdach geschlossen, hat er ausgeblüht und führt den
Sommer über ein Schattendasein.
Der Waldmeister ist eine ausdauernde, krautige
Pflanze, die eine Wuchshöhe von 15 bis 30 cm erreicht.
Er hat einen unterirdisch kriechenden Wurzelstock, der
schon im Herbst die Triebe für das Folgejahr bildet. Der
Standort des Waldmeisters ist oft sehr feucht und die
Luft über dem Boden mit Feuchtigkeit fast gesättigt.
An diesen Standorten ist die Verdunstung der Pflanzen
sehr stark herabgesetzt. Das führt zum Stocken des
aufstrebenden Saftstroms, der die Nährstoffe zu Blättern
und Blüten bringt.
Wachstum und Lebenstätigkeit werden behindert. Dagegen
hat der Waldmeister eine pfiffige Strategie entwickelt.


Er hat Wasserspalten an den Außenseiten der Blätter
gebildet, da wo die Hauptrippen enden.
Über diese Spalten wird das überschüssige Wasser
ausgepresst.
Die blitzenden Wassertröpfchen, Diamanten gleich, werden
im Allgemeinen für kondensierte Tautröpfchen gehalten,
sind aber in Wirklichkeit ausgeschiedenes Wasser.
Eigenartig ist sie Blattstellung des Krautes. Die
Blätter sind einadrig und zu einem sternförmigen Quirl
stockwerkartig angeordnet, wobei sie immer in
Formationen von
sechs bis acht lanzenförmigen Blättern stehen,
deren Stengel vierkantig sind.
Als Kraut wird der Waldmeister vor der Blüte gepflückt.
Seine wahre Schönheit entfaltet er aber erst mit de
Blüte. Elfengleich steht er dann mit seinen
porzellanweißen, vierstrahligen Blütensternen da. Die
sind trotz ihrer Zartheit weithin sichtbar, weil sie
sich zu einer endständigen, reichverzweigten, lockeren
Trugdolde vereinen.
Die sich nach der Blüte bildenden, kugeligen Früchte,
sind dicht besetzt mit hakigen Borsten. Das zeigt die
Verwandtschaft des Waldmeisters mit den Labkräutern. Als
Klettfrüchte hängen sie sich an vorbeistreifende Tiere
und werden so verbreitet.
zurück
Copyright Abbildung: Archiv Copyright Text: Bernd Sternal
|
 Der
Harz - Faszination Natur Der
Harz - Faszination Natur
von Bernd Sternal |
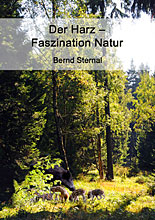
|
Wir treten
für den Schutz von Eisbären, Tigern, Löwen
und anderen Raubtieren ein, den Wolf in
Deutschland lehnen wir jedoch zum Großteil
ab und auch der teilweise wieder
angesiedelte Luchs ist vielen suspekt. Wir
schützen Tiere und Pflanzen, wobei der
Schwerpunkt auf niedlichen und
ungefährlichen Tieren liegt, bei Pflanzen
müssen diese möglichst ansehnlich sein,
hübsch blühen oder wohlschmecken.
Borkenkäfer, Fliegen, Wespen, Weg- und
Gartenameisen, Motten, Asseln und vieles
mehr haben hingegen keine Lobby, dennoch
sind sie alle Bestandteile unserer Natur.
Wir unterscheiden in Neobiota und
einheimischer Flora und Fauna. Unter
ersterem versteht man Arten von Tieren und
Pflanzen, die erst nach dem 15. Jahrhundert
hier eingeführt oder eingewandert sind. Dazu
zählen beispielsweise bei den Tieren:
Waschbären, Marderhunde, Nerze, Nutrias,
Mufflon oder Streifenhörnchen. Bei den
Pflanzen ist der Riesenbärenklau derzeit in
aller Munde, es gibt jedoch weitere
unzählige Arten. In Deutschland kommen
mindestens 1.100 gebietsfremde Tierarten
vor. Davon gelten allerdings nur etwa 260
Arten als etabliert, darunter 30
Wirbeltierarten.
Übrigens: Auch die Kartoffel, die Tomate,
der Paprika und die Gurke sind Neophyten,
also nicht heimische Arten.
Wir beginnen dann Arten in nützliche und
schädliche zu unterscheiden. Dabei nehmen
wir wenig Rücksicht auf die Rolle der
jeweiligen Art in den Ökosystemen, oftmals
kennen wir diese auch gar nicht. Wir führen
Tiere und Pflanzen aus der ganzen Welt ein
und sind dann verwundert, wenn die eine oder
andere Art außer Kontrolle des Menschen
gerät und sich unkontrolliert vermehrt. Den
Rest, in Bezug auf neobiotische Pflanzen,
Tiere und Pilze, erledigt die
Globalisierung.
Auch unsere Landschaft verändern wir
fortwährend. Was durch geologische Prozesse
in vielen Millionen Jahren entstanden ist,
weckt seit einigen Jahrhunderten das
zunehmende Interesse des Menschen. Wir
betreiben Bergbau - unterirdisch und in
Tagebauten -, wir fördern Erdöl und Erdgas
aus den Tiefen unseres Planeten, wir bauen
Sand, Kies, Kalk, allerlei Gestein und
vieles mehr ab.
Zwar versuchen wir mittlerweile den Abbau
fossiler Brennstoffe zu begrenzen und einen
Ausstieg vorzubereiten, jedoch ist die
Bauindustrie unersättlich. Unsere Städte,
Dörfer, Verkehrswege und Firmenanlagen
fordern ihren Tribut. Jedoch muss der
Großteil der Welt erst noch Straßen und
feste Gebäude erbauen. Wollen wir das diesen
Menschen versagen?
Im Buch finden Sie 71 farbige und 27
schwarz-weiße Fotos sowie mit 16 farbige und
37 schwarz-weiße Abbildungen zu den
einzelnen Themen. |
|
oder bestellen bei Amazon |
|
 |
|
|