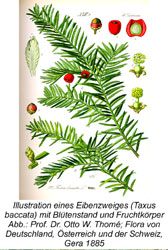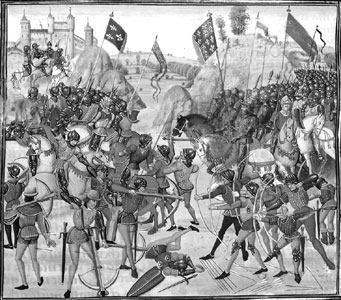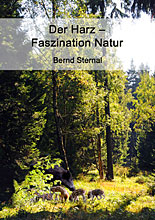Wenn man sich eine Eibe (lat.: Taxus baccata L.), mit
ihren satten, tief-grünen Nadeln und den leuchtend roten
Beerenfrüchten betrachtet, geschieht das immer häufiger
nur in Parks und Gärten, dekorativ getrimmt oder ganz
wie die Natur sie wachsen ließ.
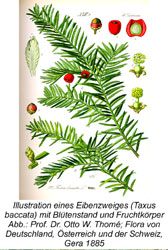
Eiben gehören zu den immergrünen Nadelholzgewächsen.
Oftmals findet man sie als sogenannte Komplexstämme -
mehrere miteinander verwachsene Stämme - vor. Die Krone
einstämmiger Eiben ist zumeist breit und kegelförmig,
mit stark verzweigtem Astwerk. Mit zunehmendem Alter
wird die Krone der Eibe rundlich bis kugelförmig. Der
Stamm ist tiefgefurcht, die Rinde ist anfänglich rötlich
und glatt, später entwickelt sich eine schuppige Borke
von graubrauner Farbe. Die gestielten Nadeln, welche
zwischen 15 bis 40 mm lang und 2 bis 3 mm breit sind,
werden auf der Oberseite dunkelgrün und glänzend, auf
der Unterseite graugrün. Die männlichen Exemplare bilden
Staubblüten, die weiblichen Blüten hingegen winzige
kleine Blüten auf der Zweigunterseite aus. Daraus
entwickeln sich die bräunlichen Samen, welche von
saftigem, leuchtend rotem Fruchtfleisch umgeben werden.
Für Vögel und das heimische Wild sind die roten
Beerenfrüchte äußerst schmackhaft, und auf diese Weise
sorgen sie für eine natürliche Verbreitung der holzigen
Samen, denn sie werden unverdaut wieder ausgeschieden.
Nur selten trifft man eine Eibe noch im Harz an. Dann
fragt sich der Betrachter: Wie kommt denn die hierher,
das ist doch sicherlich ein Baum, der irgendwann mal aus
Nordamerika eingeführt wurde? Vielleicht erinnert man
sich auch schwach daran, dass die Eibe im Jahr 1994 der
Baum des Jahres war. Nur wie kann das zusammenpassen?

Die Eibe gehört zu den vom Aussterben bedrohten Arten
und steht in vielen Ländern Europas unter Naturschutz.
Hier in Deutschland ist die Eibe auf der „Roten Liste“
für gefährdete und besonders vom Aussterben bedrohte
Pflanzenarten. Doch das war nicht immer so. Die Eibe
gehörte einst, neben den Laubbäumen und der Tanne, zum
vorherrschenden Baumbestand des Harzes.
Schon im Mittelalter und wohl auch schon davor hatten
die Menschen die Gebrauchseigenschaften dieses zähen
Holzes erkannt. Im 15. und 16. Jahrhundert stieg die
Nachfrage – auch aus dem Ausland – stark an. Die
hervorragenden Eigenschaften des Holzes wurden geschätzt
und besiegelten somit das Ende der Eibenbestände im
Harz. Das Holz der Eibe ist fast harzfrei, sehr
elastisch und zäh, dabei doch sehr dicht und schwer;
diese Eigenschaften sind dem sehr langsamen Wachstum
geschuldet. Auch sehr alte Eiben werden selten größer
als 20 Meter.

Diese Holzeigenschaften prädestinierten Eibenholz für
den Bau von Bögen und Armbrüsten. Im Mittelalter begann
somit, forciert vom Waffenbau, ein regelrechter Raubbau,
bis die Eibe nahezu vollständig aus den Wäldern des
Harzes verschwand. Historische Informationen aus dem
Harz sind dünn gesät. Dennoch gibt es Belege dafür: So
exportierte Nürnberg im Jahre 1560 die gewaltige Menge
von 36.000 Bogen in den „Westen“. Laut einer Nürnberger
Rechnung aus dem Jahre 1589 exportierte eine
Holzhandlung permanent große Mengen an Eibenholz auf
Flößen und Wagen nach Köln, Prag, Wien, Leipzig,
Augsburg, sogar bis nach England, Frankreich und
Italien. Frankfurt war in dieser Zeit eine Hochburg der
Waffenschmieden und Armbrustschnitzer, so gingen in
jenem Jahr allein 12.000 Eibenstämme nach Frankfurt.
Ein altes Gedicht mit
unbekanntem Autor besagt:
„Wir sind die letzten des Riesengeschlechts,
die Brüder sanken und starben.
Wir tragen die Spuren des Wettergefechts,
frisch blutende Wunden und Narben.“
Heute findet man in ganz Deutschland nur noch vier
mehr oder weniger große Eibenbestände, der Eibenbestand
im Bodetal ist einer davon.
Entlang des Bodetals, zwischen Thale und Treseburg,
findet man noch heute zahlreiche Eiben vor, manche in
größeren Gruppen, manche inmitten anderer Bäume und
manche alleinstehend, hoch oben in den zerklüfteten
Felsen. Viele von ihnen haben es bereits auf ein
beachtliches Alter von mehreren hundert bis zu tausend
Jahren gebracht. Doch ansehen kann man es ihnen kaum, da
sie ja durch das langsame Wachstum nicht riesig groß und
nicht von erheblichem Umfang sind.
Die Königin der Harz-Eiben, die sogenannte
Humboldt-Eibe, von den Einheimischen auch die
Tausendjährige genannt, ist in einem gut versteckten
Seitental zu finden, dessen Name hier nicht genannt sein
soll. Dieses Tal ist ein Naturschutzgebiet, in dessen
Schutz die Humboldt-Eibe steht.
Den Naturschützern in Thale und im gesamten Harz ist
sehr daran gelegen, dass keine Touristenströme durch
dieses Tal kommen und somit das Naturschutzgebiet, als
auch die Humboldt-Eibe, gefährden. Ihre üppigen und
stark verschlungenen Wurzeln ranken sich über den
felsigen Boden. Im Inneren ist die Eibe hohl, so dass
man sich getrost hineinstellen könnte. Der Stamm selbst
ist nur noch ein schmaler Ring. Die Öffnung verjüngt
sich spitz noch oben und trotz des beträchtlichen Alters
ist von Fäulnis keine Spur. Die Humboldt-Eibe verdankt
ihren Namen, wie zu vermuten ist, dem Naturforscher
Alexander von Humboldt (1769 - 1859). Denn dieser war
Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, der Erste,
der diese Eibe beschrieb und ihr Alter schätzte.
Wohlgemerkt: Es war zu jener Zeit noch keine Wanderung
durch das Bodetal auf gut ausgebauten Wegen möglich. Die
Wanderung zur Eibe – die später Humboldt-Eibe heißen
sollte – war sehr beschwerlich. Humboldts Schätzung
belief sich bei der Eibe auf ein Alter von etwa 4.000
Jahren.
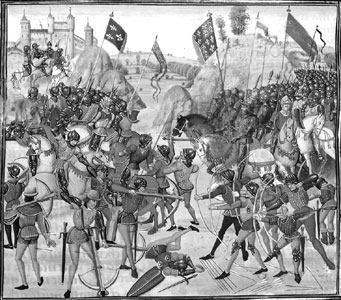
Schlacht von Crécy des Hundertjährigen Krieges zwischen
Engländern und Franzosen,
rechts Langbogenschützen
Maler: Jean Froissart (1337 - 1405)
Französische Nationalbibliothek FR 2643, fol. 165v
Heute weiß man, dank dendrochronologischer
Schätzungen, dass die Eibe ein ungefähres Alter von
2.000 bis 2.500 Jahren hat. Eine genauere Datierung
ihres Alters wäre nur durch eine intensive
dendrochronolo-gische Untersuchung möglich, die eine
Probenentnahme voraussetzen würde. Doch die
Naturschützer möchten zu Recht darauf verzichten.
Dennoch ist die Humboldt-Eibe vermutlich einer der
ältesten Bäume in Deutschland.
Umso erfreulicher ist, dass die Eiben im Bodetal und
in dessen Umgebung in naher Zukunft ihre Renaissance
erleben sollen. Der Thalenser Forst arbeitet mit großer
Zuversicht seit einiger Zeit an einem „Eibenprojekt“.
Ziel dieses Projektes ist es, die Eiben wieder vermehrt
im Harz anzusiedeln. Dazu werden den heimischen Eiben
Samen entnommen, junge Eiben gezogen und mit ihnen
aufgeforstet. Außerdem gewinnt die Eibe in der Medizin
immer mehr an Bedeutung. Bezeichnete sie der römische
Fachschriftsteller Plinius noch als Baum des Todes, so
gewinnt man heute das Krebsmittel „Taxol“ aus ihrer
Rinde.


Eiben im Bodetal - Humboldt-Eibe, Fotos K. Brinkmann
Doch bis die Menschen hier im Harz wieder durch
Eiben-Wälder streifen können, werden noch viele hundert
Jahre vergehen.
zurück
Copyright der Fotos: B. Sternal, Archiv,
Copyright des Textes: "Der Harz – Faszination Natur" von
Bernd Sternal
|
 Der
Harz - Faszination Natur Der
Harz - Faszination Natur
von Bernd Sternal |
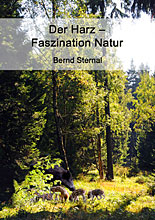
|
Wir treten
für den Schutz von Eisbären, Tigern, Löwen
und anderen Raubtieren ein, den Wolf in
Deutschland lehnen wir jedoch zum Großteil
ab und auch der teilweise wieder
angesiedelte Luchs ist vielen suspekt. Wir
schützen Tiere und Pflanzen, wobei der
Schwerpunkt auf niedlichen und
ungefährlichen Tieren liegt, bei Pflanzen
müssen diese möglichst ansehnlich sein,
hübsch blühen oder wohlschmecken.
Borkenkäfer, Fliegen, Wespen, Weg- und
Gartenameisen, Motten, Asseln und vieles
mehr haben hingegen keine Lobby, dennoch
sind sie alle Bestandteile unserer Natur.
Wir unterscheiden in Neobiota und
einheimischer Flora und Fauna. Unter
ersterem versteht man Arten von Tieren und
Pflanzen, die erst nach dem 15. Jahrhundert
hier eingeführt oder eingewandert sind. Dazu
zählen beispielsweise bei den Tieren:
Waschbären, Marderhunde, Nerze, Nutrias,
Mufflon oder Streifenhörnchen. Bei den
Pflanzen ist der Riesenbärenklau derzeit in
aller Munde, es gibt jedoch weitere
unzählige Arten. In Deutschland kommen
mindestens 1.100 gebietsfremde Tierarten
vor. Davon gelten allerdings nur etwa 260
Arten als etabliert, darunter 30
Wirbeltierarten.
Übrigens: Auch die Kartoffel, die Tomate,
der Paprika und die Gurke sind Neophyten,
also nicht heimische Arten.
Wir beginnen dann Arten in nützliche und
schädliche zu unterscheiden. Dabei nehmen
wir wenig Rücksicht auf die Rolle der
jeweiligen Art in den Ökosystemen, oftmals
kennen wir diese auch gar nicht. Wir führen
Tiere und Pflanzen aus der ganzen Welt ein
und sind dann verwundert, wenn die eine oder
andere Art außer Kontrolle des Menschen
gerät und sich unkontrolliert vermehrt. Den
Rest, in Bezug auf neobiotische Pflanzen,
Tiere und Pilze, erledigt die
Globalisierung.
Auch unsere Landschaft verändern wir
fortwährend. Was durch geologische Prozesse
in vielen Millionen Jahren entstanden ist,
weckt seit einigen Jahrhunderten das
zunehmende Interesse des Menschen. Wir
betreiben Bergbau - unterirdisch und in
Tagebauten -, wir fördern Erdöl und Erdgas
aus den Tiefen unseres Planeten, wir bauen
Sand, Kies, Kalk, allerlei Gestein und
vieles mehr ab.
Zwar versuchen wir mittlerweile den Abbau
fossiler Brennstoffe zu begrenzen und einen
Ausstieg vorzubereiten, jedoch ist die
Bauindustrie unersättlich. Unsere Städte,
Dörfer, Verkehrswege und Firmenanlagen
fordern ihren Tribut. Jedoch muss der
Großteil der Welt erst noch Straßen und
feste Gebäude erbauen. Wollen wir das diesen
Menschen versagen?
Im Buch finden Sie 71 farbige und 27
schwarz-weiße Fotos sowie mit 16 farbige und
37 schwarz-weiße Abbildungen zu den
einzelnen Themen. |
|
oder bestellen bei Amazon |
|
 |
|